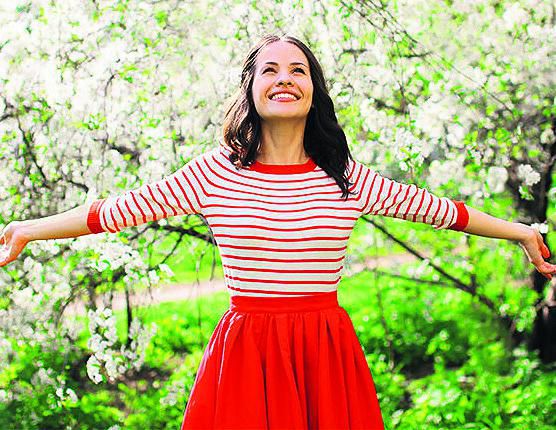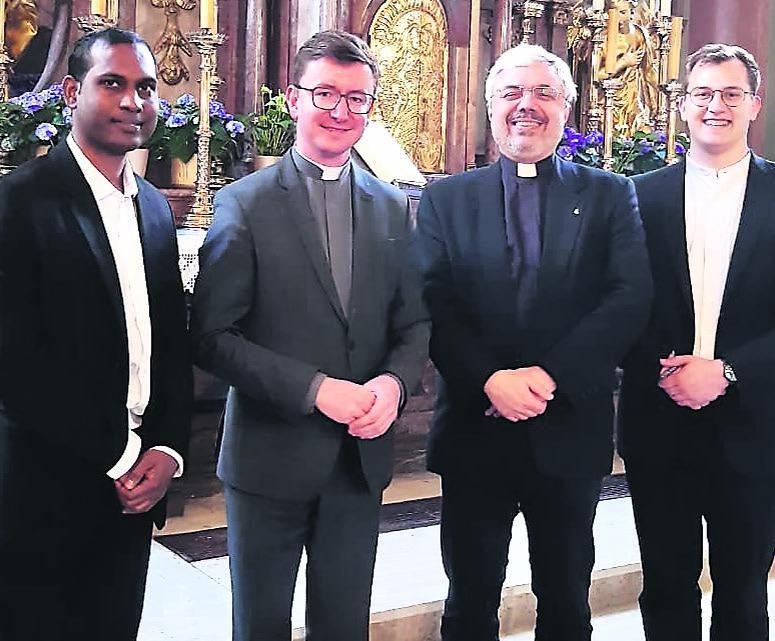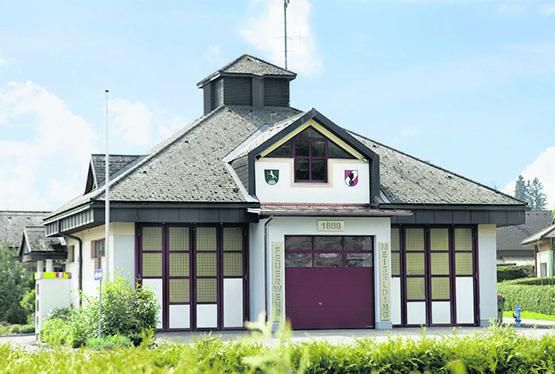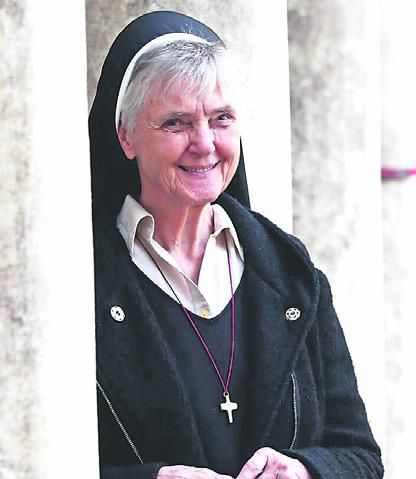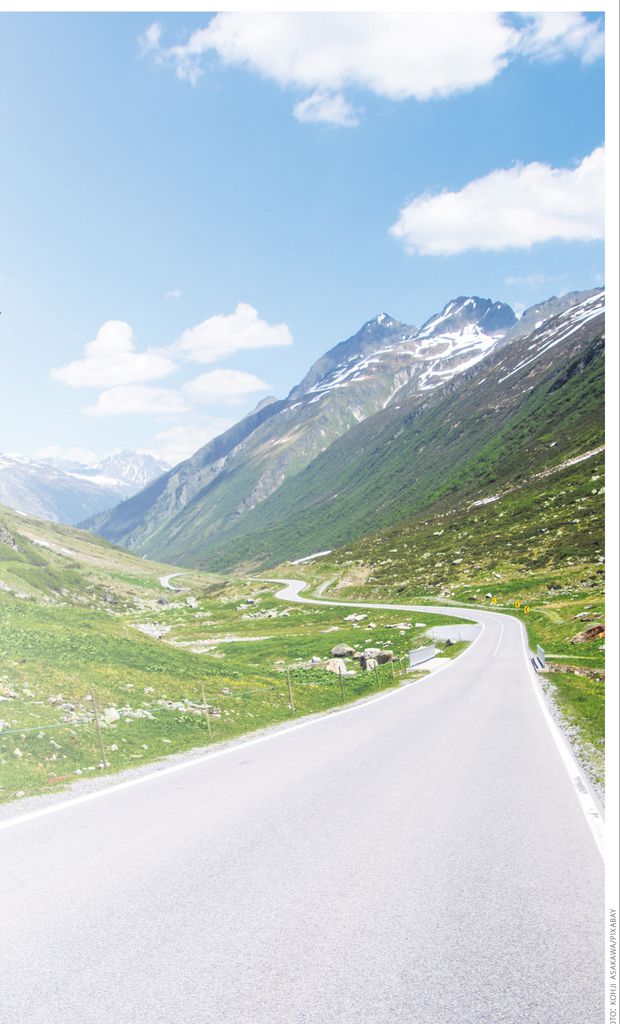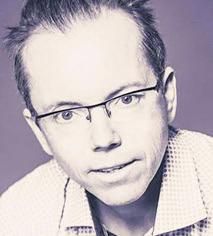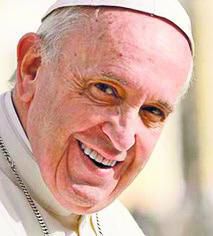Wozu eine Frauenliturgie?

„Was ist eigentlich eine Frauenliturgie?“ werde ich gefragt. „Na eine Liturgie, die Frauen gestalten“, antworte ich. Und während mir ob der Banalität der Antwort die Schamesröte im Gesicht aufsteigt, hole ich mir einen Schub Selbstbewusstsein. Ja, es ist eine Liturgie, die Frauen gestalten und das tun, was sie sonst in einer Liturgie eher nicht tun: Gestaltung. Bewegung. Und vor meinem geistigen Auge sehe ich – wie man sich das eben so vorstellt – bunte Tücher, tanzende Frauen, lachende und weinende Gesichter, durch die Luft fliegende Gedanken, weihrauchgeschwängerte Bitten und handgreifliche Symbole. Pfeif auf das Klischee, denke ich mir. Es ist eben ein Bedürfnis – von uns Frauen? – aktiv zu werden. Liturgie zum Angreifen, zum Mittun.
„Na, und warum soll das nur weiblich sein“, höre ich mein mitfühlendes Gegenüber fragen – obwohl es das gar nicht tut. „Vielleicht gibt es ja auch Männer, die eine Liturgie zum Angreifen wollen.“ Ja, natürlich sind Männer genauso willkommen, zum Mitbeten, zum Mitdenken und zum Mitgestalten. Die Bezeichnung Frauenliturgie ist möglicherweise aus der Not heraus entstanden, weil Frauen irgendwann einfach begonnen haben, etwas zu tun, was eben nicht normal, was ungewöhnlich oder auch nicht erwünscht war. Irgendwann stellten sich Frauen in den Altarraum. Sie sagten laut, was sie sich zu den Erzählungen der Bibel denken. Sie begannen zu singen und tanzen, wie die Prophetin Mirjam. Frauen lernten von Jesus da-zu-sein und anders-zu-sein. Sie spürten, wie sich die Geistkraft Gottes ausbreiten wollte und gaben ihr Raum. Und so wurde Frauenliturgie auch für mich eine willkommene Gelegenheit, das zu tun, wofür mein Herz brennt: bewegte Begegnung mit Gott.